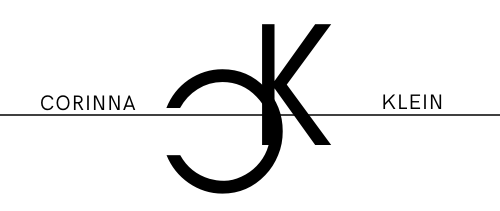Ein Interview mit der Intensivpflegekraft Julia-Mareen Vetter der Thorax-Klinik Heidelberg.
Ich spreche heute mit Julia-Mareen Vetter, Fachexaminierte Krankenpflegerin für Anästhesie und Intensivpflege, Studium der angewandten Gesundheitswissenschaften, Weiterbildung zur Atmungstherapeutin.
Frau Vetter, Sie arbeiten seit vielen Jahren auf verschiedenen Intensivstationen. Wie haben Sie die letzten zwei Jahre erlebt?
Meinen ersten beruflichen Kontakt zu an dem Coronva-Virus erkrankten Patienten erlebte ich Anfang November 2020. Aufgrund der Fachweiterbildung kehrte ich erst zu Beginn der zweiten Welle auf die Intensivstation der Thoraxklinik zurück. Im Umgang mit Infektionskrankheiten sind wir erfahren und doch war das für uns alle eine komplett neue Situation. Wir betreuten auf unserer Intensivstation ausschließlich schwere Coronaverläufe. Es ist körperlich sehr anstrengend stundenlang in Schutzkleidung und FFP3 Maske zu arbeiten. Dazu kommt die enorme psychische Belastung: Patienten mit einer Viruserkrankung zu betreuen, über die man zu Beginn wenig wusste, die weltweit eine Pandemie verursacht und oft auch tödlich verlief. Covid-19 verursacht viele Komplikationen, ist im Verlauf oft unberechenbar. Die meisten Patienten wussten nicht, wo oder bei wem sie sich infiziert hatten und auch ich hatte, trotz ausreichend Schutzmaterial, oft Angst mich selbst und schlimmstenfalls meine Angehörigen zu infizieren.
Wie ist die Lage heute?
Tatsächlich hatten wir zu jedem Zeitpunkt der Pandemie Corona-Patienten bei uns auf der Station liegen. Zum Höhepunkt der zweiten Welle war die ganze Station komplett isoliert. Wir hatten zu dieser Zeit keine anderen Patienten bei uns liegen. Operationen wurden zu dieser Zeit, ähnlich wie jetzt wieder, auf ein Minimum beschränkt. Postoperative Patienten wurden im Aufwachraum der Anästhesie überwacht, welcher dafür 24h betreut wurde. Intensivpflichtige Patienten ohne Covid-19 wurden auf unserer Nachbarstation mit Monitorüberwachung und ggf. Beatmung betreut, die Kollegen dort wurden somit auch mit einer für sie neuen Situation konfrontiert. Gegenwärtig ist unsere Station teilisoliert, das heißt wir betreuen wieder sowohl Coronapatienten, postoperative Patienten und andere intensivpflichtige Patienten.
Können Sie den Leser erklären, wie man sich die Arbeit auf der Intensivstation vorstellen kann?
Ähnlich zu der Arbeit auf Normalstation gibt es schichtabhängige Schwerpunkte wie Körperpflege, Mobilisation, Atmungstherapie, Diagnostik, Verbandwechsel, Visiten und so weiter. Allerdings befinden sich unsere Patienten in wesentlich kritischerem Zustand, weshalb eine kontinuierliche Überwachung der Kreislaufsituation über einen Monitor erfolgen muss. Es können zu jeder Zeit Notfallsituationen entstehen, die ein schnelles Handeln erfordern. Alle Mitarbeiter befinden sich in ständiger Alarmbereitschaft. Wir versuchen den Lautstärkepegel möglichst gering zu halten, allerdings verwenden wir sehr viele medizintechnische, lebenserhaltende Geräte, deren verschiedene akustische Alarme wir differenzieren können müssen. Eine Pflegekraft betreut zwei Patienten. Die Versorgung eines intensivpflichtigen Coronapatienten ist im Vergleich zu anderen intensivpflichtigen Patienten um ein Vielfaches aufwendiger. Diese Patienten werden vermehrt in Bauchlage gedreht, erhalten extrakorporale Unterstützungsverfahren (Lungenersatzverfahren außerhalb des Körpers), wie ECMO, die mit ständiger Anwesenheitspflicht im Patientenzimmer überwacht werden muss, alles in vollständiger Schutzkleidung.
Was ist bei Corona-Patienten anders als bei Intensiv-Patienten anderer Krankheitsbilder?
Corona ist eine Krankheit mit vielen Facetten. Auch nach einem Jahr ist vieles noch unklar. Wir wissen, dass oftmals primär die Lunge, häufig irreversibel, geschädigt wird, aber auch alle anderen Organe können beteiligt sein. Neben der Coronainfektion können diese Patienten zeitgleich Thrombosen, eine Sepsis und daraus resultierend ein Multiorganversagen entwickeln. Was die Arbeit absolut von der Betreuung anderer Krankheitsbilder differenziert, ist die Situation der Angehörigen. Aktiv infektiöse Patienten dürfen nicht besucht werden. Die einzige Form der Kommunikation, wenn der Patient nicht mehr bei Bewusstsein ist, ist das Angehörigentelefon, welches ausschließlich unsere Ärzte bedienen. Es ist eine Herausforderung den Zustand ehrlich und authentisch am Telefon wiederzugeben.
Für mich war es jedes Mal auch eine mentale Herausforderung, Angehörige auf unserem Stationsflur zu begegnen, weil ich wusste, dies bedeutet, dass erneut ein Corona-Patient im Sterben liegt.
Wie geht es den Corona-Patienten psychisch und physisch?
Wenn die Patienten in wachem Zustand zu uns kommen, wurden sie in der Regel bereits zuvor auf der Normalstation über eine nasale Sauerstoffbrille zusätzlich mit Sauerstoff versorgt. Die Patienten erschöpfen sich zusehends. Die Luft ist dermaßen knapp, dass sie nicht nur oftmals Atemnot, gepaart mit der Angst zu ersticken aufweisen, sondern auch nicht mehr in der Lage sind, sich beispielsweise selbständig aufzusetzen oder zu trinken. Die Patienten haben Angst zu sterben, sie haben keine Reserven mehr und trotz hoch konzentrierter zusätzlicher Sauerstoffversorgung zeigt eine Analyse der Blutgase, dass der Sauerstoffgehalt im Körper viel zu gering ausfällt. Dieser Zustand ist für die Patienten mit unfassbarem Leid und Angst verbunden. Wir versuchen die invasive Beatmung und das Einleiten eines künstlichen Komas so lange wie irgendwie möglich zu verhindern. Manchmal gelingt dies, oftmals nicht. Mit künstlicher Beatmung drehen wir die sedierten Patienten für mindestens 16h auf den Bauch, um damit die Durchblutung und auch die Belüftung von Lungenarealen zu verbessern. Ist zu Lunge zu stark geschädigt, nutzt man das Lungenersatzverfahren, die sogenannte ECMO. Dabei wird der Lungenkreislauf über eine Maschine außerhalb des Körpers nachgestellt. Die ECMO verschafft dabei ein Zeitfenster, in welcher die Lunge selbst heilen kann oder fungiert als Ersatz bis zu einer Lungentransplantation. Bestehen diese beiden Optionen nicht und die Lunge ist irreversibel stark geschädigt, wird der Patient versterben. Natürlich gibt es glücklicherweise auch Patienten die diese wochen- oder sogar monatelange Maximaltherapie überleben und nach und nach von ECMO, als auch künstlicher Beatmung entwöhnt werden können. Sie erlernen von neuem zu sprechen, schlucken, husten, essen und trinken und sich selbständig wieder zu bewegen. Ein langer, sehr schwieriger Weg liegt hinter ihnen, oftmals dem Tod näher als dem Leben, von Komplikationen, Rückschlägen geprägt. Eine Anschlussbehandlung in einer REHA-Einrichtung ist essentiell.
Vielen ist nicht bewusst, dass an eine Lebensqualität wie vor der Coronainfekton nicht mehr zu denken ist.
Welche Patienten landen mittlerweile auf Ihrer Station?
Innerhalb der zweiten Welle waren die Patienten primär multipel vorerkrankt; Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht, Lungenerkrankungen und die Patienten waren über 70 Jahre alt. Mittlerweile hat sich der Altersdurchschnitt deutlich nach unten korrigiert. Gegenwärtig werden die Patienten jünger und sind oftmals ohne Vorerkrankungen, wenn sie auf unsere Station gelangen. Ich nehme die vierte Welle aber besonders als Welle der Ungeimpften wahr. Ich erinnere mich aktiv auch nur an einen einzigen Fall eines schwer herzerkrankten, doppelt geimpften über 80jährigen, der bei uns auf der Station lag. Ansonsten hatten wir bislang keinerlei Impfdurchbrüche.
Ein besonders tragischer Fall eines 31-Jährigen ohne Vorerkrankungen ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Er erlitt einen schweren Coronaverlauf, mit sämtlichen Komplikationen, wurde dauerhaft beatmet via Luftröhrenschnitt, hatte mehrere künstliche Darmausgänge, einen sogenannten Platzbauch. Er kam nach zur Entwöhung von der Beatmung zu uns. Immer wieder entwickelte er Fieber über 40 Grad, neue Infekte, erhielt Massentransfusionen aufgrund plötzlicher hoher Blutverluste, dazu entwickelte er ein Leberversagen. Dieser Patient war wach und oft schmerzgeplagt, was man deutlich an seinem Gesicht ablesen konnte. Er selbst hatte jeglichen Lebenswillen verloren, was er auch kommunizierte. Er lag über Monate bei uns. Mental tat es unendlich weh, diesen Patienten, unwesentlich älter als ich selbst, zu betreuen. Nach vielen Wochen wurde ein Ethikkonsil einberufen und final durfte er bei uns, ohne Schmerzen, versterben.
Wie erleben Sie den Kontakt zu Angehörigen?
Solange die Patienten in der Lage sind ihre Handys zu nutzen, dürfen sie diese uneingeschränkt verwenden, um den Kontakt zu ihren Angehörigen zu halten. Wenn sich ihr Zustand dahingehend verschlechtert, dass sie ihr Handy motorisch nicht mehr selbstständig benutzen können, unterstützen wir, indem wir auf deren Wunsch ein Bild der Patienten machen und es an Angehörige versenden oder bei Gesprächen behilflich sind. Angehörige dürfen das Coronazimmer nicht betreten. Für Patienten, deren Zustand für eine Kommunikation zu schlecht ist, gibt es ein extra hierfür eingerichtetes Angehörigentelefon, welches nur von einem Arzt als Ansprechpartner bedient wird.
Wenn wir Patienten unter invasiver Beatmung aus dem künstlichen Koma schrittweise aufwachen lassen, unterstützen wir diesen Prozess von pflegerischer Seite, indem wir uns von Angehörigen Fotos, Zeichnungen und andere Erinnerungen geben lassen, die wir aufhängen, sowie persönliche Gegenstände wie Kuscheltiere, Glücksbringer oder besondere Gegenstände. Wir lassen uns auch MP3 Player mit der Lieblingsmusik und/oder Sprachnachrichten der Liebsten geben, welche wir den Patienten vorspielen. So versuchen wir den Patienten eine vertrautere Umgebung zu schaffen.
Ein Patientenzimmer ist etwas sehr Unpersönliches, überall blinken Lampen, ständig ertönen Alarme, man befindet sich noch unter invasiver Beatmung, kann nicht sprechen und den Patienten fehlen Tage bis Wochen der Erinnerung. Ich persönlich stelle mir diese Situation der Patienten sehr belastet vor.
Nicht selten sind Patienten verwirrt, unruhig, im schlimmsten Fall selbstgefährdend. Wir Pflegekräfte sind dabei besonders gefordert, den Patienten zu schützen und ihn dabei zu unterstützen Reorientierung zu erhalten.
Welche Auswirkungen auf Ihre Motivation hat das Verhalten von Impfgegnern und Corona-Leugnern, die womöglich noch bei Ihnen auf der Station landen?
Ich mache natürlich keine Unterschiede zwischen Geimpften und Ungeimpften bei den pflegerischen Maßnahmen. Jeder bekommt die bestmögliche, verfügbare Behandlung. Ich habe jedoch mittlerweile aufgehört, mich auf endlose Diskussionen einzulassen, beispielsweise mit Angehörigen, die keinen Schnelltest machen wollen, obwohl sie schwer an Corona erkrankte Personen bei uns besuchen möchten. Wir erleben leider auch immer wieder Situationen, in denen Angehörige erheblich Zeit und Kapazitäten beanspruchen, indem sie Maßnahmen ignorieren und torpedieren und sich beispielsweise auch durch Mitarbeitereingänge einschleichen. Es gibt sogar Angehörige, die zweifeln Corona auch dann noch an, wenn der Patient bei uns im Sterben liegt und geben vielmehr uns die Schuld, behaupten gar, er sterbe aufgrund von ärztlicher Behandlungsfehler (Highlight). Final macht sich Resignation breit, man verstummt. Meine Empathie ist für Impfgegner oder Coronaleugner definitiv geringer. Ein vollständiger Impfschutz schützt vor einem schweren Verlauf und natürlich hinterfrage ich, warum die betroffenen Patienten sich gegen eine Impfung entschieden haben. Ich denke, dass uns Corona auf der Intensivstation noch einige Zeit verfolgen wird. Die Arbeit ist anspruchsvoll, körperlich anstrengend, mental verausgabend und natürlich war der Personalmangel schon vor Corona vorhanden, hat sich aber jetzt nochmal verstärkt. Insbesondere Patienten mit ECMO Therapien benötigen speziell geschultes, sehr erfahrenes Personal, doch mittlerweile müssen wir mitunter auch Mitarbeiter mit einem halben Jahr Intensiverfahrung diese Patienten betreuen lassen.
Ich würde meine Arbeitszeit reduzieren, um mich und meine Gesundheit zu schützen, wenn wir wieder in die gleiche Situation kommen, wie letztes Jahr in der Winterzeit. Einige Alpträume verfolgen mich bis heute.
Gibt es eine Situation, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Es gab eine Familie, direkt hier aus Heidelberg, die komplett an Corona erkrankt ist. Des Patienten Vater und auch Mutter sind beide daran verstorben, wie auch er auch beinahe selbst gestorben wäre. Er lag mit einem schwersten Corona-Verlauf und vielen Komplikationen unter einer ECMO Therapie bei uns auf der Station, dem Tod immer wieder näher als dem Leben. Er hatte gar keine Vorerkrankungen und wurde auf eine Lungentransplantation vorbereitet. Dazu wurde er dann, nach monatelanger Therapie, nach München geflogen und kam zwei Monate später ohne ECMO und ohne Lungentransplantat zu uns zurück. Seine Lunge hatte sich durch die notwendige medizinische Unterstützung selbst regeneriert. Geschichten wie diese, gefühlt ein Wunder, machen mir Hoffnung und geben meiner Arbeit wieder einen Sinn.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
In Anbetracht der Pandemie und der nun vierten Welle wünsche ich mir, dass die Menschen weniger an sich selbst und wieder mehr an andere denken, Rücksicht und Solidarität leben, Das beginnt dabei die Maske richtig zu tragen und Abstände einzuhalten. Man kann Maßnahmen als für sich selbst übertrieben betrachten, es geht aber nicht darum, selbst jung und nicht vorerkrankt zu sein. Es geht darum, vulnerable Gruppen zu schützen, die eigenen Eltern, Großeltern, Kinder. Es frustriert, dass Menschen die Notwendigkeit der Maßnahmen, auch der Impfung oft erst erkennen, wenn es bereits einen Angehörigen schwer getroffen hat und dieser schlimmstenfalls verstirbt. Wir haben durch die Impfung die Option schwere Verläufe dieser Viruserkrankung zu minimieren. Jeder Mensch in Deutschland hat ein Impfangebot erhalten. Ich würde mir wünschen, dass die Impfquote steigt. Ich wünsche mir, dass Menschen mit Vorbehalten nach nunmehr zwei Jahren endlich erkennen, dass eine hohe Impfquote die Möglichkeit für ein Zurückgewinnen der Normalität bietet.